
Jeden Morgen in einem georgischen Bergdorf beginnt mit weichem Licht, das durch schmale Fenster steinernes Häuser erhellt, Tau auf Kräutern draußen, das Muhen der Schafe auf Terrassen und Rauch, der von Öfen aufsteigt, in denen einfache Frühstücksmahlzeiten zubereitet werden nach alten Rezepten, die von Großmüttern weitergegeben wurden; hier fließt das Leben langsam, verbunden mit der Natur, den Jahreszeiten, Familie, Glaube. Kinder lernen, Tiere zu versorgen, sobald sie laufen können, Ziegen und Schafe im Sommer auf die Weiden, im ersten Frost zurückzubringen, und bei jeder Aufgabe – vom Melken bis zum Weben – nehmen sie Lieder, Geschichten und Umgangsformen auf, die seit Jahrhunderten bestehen. Auf den Feldern pflegen die Älteren Weizen, Gerste oder Kartoffeln wie seit Generationen, säen nach alten Kalendern, beobachten Mond und Wetter, wann gesät, wann geerntet wird, während die Jungen helfen und dafür lernen, das Land zu lesen. Feste gliedern das Jahr: Erntefeste, bei denen Nachbarn zusammen Wein und Brot herstellen, saisonale Rituale, um Heilige oder Ahnen zu ehren, Feierlichkeiten vor den Wintern und beim Frühlingserwachen. Musik hallt in diesen Zeiten – polyphones Singen in Svaneti, alte Balladen in Khevsureti – Stimmen verweben sich in Mustern, die Jung und Alt noch erinnern, selbst wenn manche Wörter verblassen. Sprache und Dialekte überleben, weil zu Hause und beim Fest die lokale Sprache gesprochen wird: Zungenbrecherische Sprichwörter, Wiegenlieder, Rätsel, Witze, die nur jene verstehen, die den Ort kennen. Handwerk wird bewahrt: Wollweben, Holzschnitzerei, Steinmetzarbeiten, Stickerei traditioneller Kleidung, Werkzeugherstellung von Hand; Ältere lehren die Jungen, oft informell durch Zuschauen und Tun, abends am Herd, im Sommer unter weitem Himmel. Religion und Ritual bleiben zentral: Gottesdienste jeden Sonntag, Feiertage der Heiligen, Beerdigungen und Hochzeiten, Segnungen von Vieh und Feldern, manchmal alte heidnische oder volkstümliche Bräuche in christliche Praxis verwoben. Durch gegenseitige Hilfe – wenn Nachbarn gemeinsam ein Dach bauen, in harten Wintern Lebensmittel teilen, Werkzeuge leihen – bleiben soziale Bindungen stark; Respekt vor Älteren ist nicht nur Höflichkeit, sondern Grundlage: sie sind Schatzkammern der Erinnerung, wie es war vor Straßenbau, vor Strom, vor Telefonen. Moderne kommt – einige Dörfer haben Strom, Handys, sogar Internet – doch viele Familien bewahren bewusst Einfachheit: Kochen mit Holz, Wasser aus Quellen holen, traditionelle Kräutermedizin verwenden, Verschwendung vermeiden, Ahnen ehren. Die jüngere Generation zieht oft weg, studiert fern, doch viele kehren zu Festen oder im Sommer zurück, bringen Ideen mit, schließen sich wieder dem Rhythmus an – lernen die alten Gerichte zu kochen, die alten Lieder zu singen, alte Häuser zu restaurieren, traditionelle Kleidung bei besonderen Anlässen zu tragen. In diesem Wechselspiel von Wandel und Kontinuität wird der Alltag in einem Bergdorf zur lebenden Wobenarbeit: jede Generation näht ihren eigenen Faden ein, doch das Muster – von Respekt, Handwerk, Gesang, Weisheit, Zugehörigkeit – bleibt
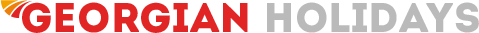





 English
English
 русский
русский
